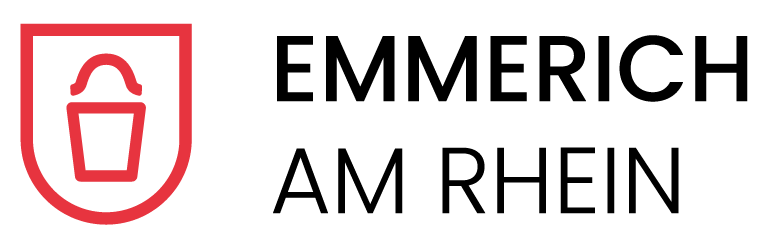hier: Erarbeitungsbeschluss
Beschlussvorschlag
Der Ausschuss für
Stadtentwicklung beauftragt die Verwaltung mit der Erarbeitung einer
Stellplatzsatzung mit besonderer Berücksichtigung der Innenstadt.
Sachdarstellung :
Erfordernis
Die neue Bauordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung – BauO NRW) wurde am 15. Dezember 2016 vom Landtag NRW
beschlossen. Darin wurden die bisher landesweit gültigen Regelungen zur
Herstellung von Stellplätzen in die Verantwortung der Gemeinden übertragen. Nach
einer Übergangsfrist entfällt die generelle Stellplatzpflicht ab dem
01.01.2019. Danach richtet sich die Stellplatzpflicht, mit Ausnahme der
Stellplätze für Menschen mit Behinderungen nach dem neuen § 50 Abs. 2 BauO NRW,
allein nach der gemeindlichen Satzung gem. § 50 Abs. 1 BauO NRW. Mit
Inkrafttreten der Landesbauordnung am 28.12.2017 sind die Gemeinden ermächtigt,
eigene Satzungen zu erlassen.
Derzeit liegt
seitens der neuen Landesregierung ein Moratorium vor, das Inkrafttreten der
Novelle der Landesbauordnung um ein Jahr zu verschieben. D. h. die
Ermächtigungsgrundlage für die Gemeinden für eigene Satzungen verschiebt sich
auf Ende 2018, die generelle Stellplatzpflicht entfällt erst zum 01.01.2020.
Aktuell ist das Gesetzgebungsverfahren jedoch noch nicht abgeschlossen.
Inhalte einer Stellplatzsatzung
Im Rahmen einer
Stellplatzsatzung wird die Anzahl herzustellender bzw. nachzuweisender
PKW-Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder festgeschrieben. Die Kommune
bestimmt von ihrer verkehrlichen und raumstrukturellen Lage Richtzahlen für
verschiedene Nutzungen. Diese Richtzahlen beziehen sich auf jeweils ein
bestimmtes Nutzungsmaß (z. B. die Anzahl der Wohneinheiten oder die Größe von
Nutzflächen). Sie können für verschiedene Teile des Gemeindegebiets variieren.
Grundsätzlich fiel
die Nachweispflicht für einen Stellplatz bei einer genehmigungspflichtigen
Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung an.
Durch den Erlass
einer Stellplatzablösesatzung in bestimmten Bereichen muss der erforderliche
Stellplatz nicht hergestellt werden, wenn der Bauherr für jeden nicht
hergestellten Stellplatz einen Ablösebetrag an die Kommune zahlt. Diese
verwendet die Ablösebeträge für Maßnahmen die mittelbar oder unmittelbar der
Baumaßnahme dienen. Es können maximal 80 % der Kosten für einen durch die
Kommune errichteten Stellplatz angesetzt werden. Von dieser Möglichkeit hat die
Stadt Emmerich im Innenstadtbereich Gebrauch gemacht.
Mustersatzung
Das „Zukunftsnetz
Mobilität NRW“ hat in Zusammenarbeit mit dem Städtetag, dem Städte-und
Gemeindebund, dem Landkreistag sowie der Arbeitsgemeinschaft für fußgänger- und
fahrradfreundliche Städte (AGFS) einen Leitfaden zur Musterstellplatzsatzung
NRW mit einem entsprechenden Formulierungsvorschlag für kommunale
Stellplatzsatzungen entworfen. Der Leitfaden enthält alle notwendigen
Informationen für Kommunen und politische Entscheidungsträger. Er kann unter
der folgenden Internetadresse heruntergeladen werden:
http://www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de/leitfaden-kommunale-stellplatzsatzungen
Die Mustersatzung
ist als Anlage beigefügt. In der Tabelle zum Stellplatznachweis für
verschiedene Nutzungsarten sind die wesentlichen Abweichungen zur bisherigen
Verwaltungsvorschrift gekennzeichnet. Insbesondere eine Spalte für abweichende
Regelungen in gut mit dem ÖPNV erschlossene Gebiete sowie eine Spalte für
Fahrradabstellanlagen sind neu hinzugekommen.
Wohnbauvorhaben sind in zwei Kategorien (1-2 Familienhäuser und
Mehrfamilienhäuser) unterteilt worden. Bisher war pauschal 1 Stellplatz pro
Wohneinheit vorgeschrieben.
Grundsätzlich gibt
die Mustersatzung einen größeren Spielraum vor als die bisherige Vorschrift.
Die Stellplatzerfordernisse können in der kommunalen Satzung enger gefasst oder
für Abwägungsspielraum im Einzelfall beibehalten werden.
Die Mustersatzung
soll als Richtschnur für eine auf die Belange der Stadt Emmerich am Rhein
zugeschnittene Stellplatzsatzung dienen. Die Ausformulierung soll im nächsten
Schritt geschehen.
Ziele der Stadt Emmerich am Rhein
Insbesondere in der
Emmericher Innenstadt besteht Handlungsbedarf bezüglich der Stellplätze. Zum
einen sind Bauvorhaben i. d. R. im Bestand durch Abriss und Neubau, somit also
nur auf engem Raum möglich. Zum anderen kann schon eine genehmigungspflichtige
Umnutzung einer Gewerbeeinheit den Nachweis von Stellplätzen erfordern, die
faktisch auf dem eigenen Grundstück nicht nachgewiesen werden können.
Insbesondere für kleinere Ladenlokale in den gewachsenen Einzelhandelslagen ist
der Stellplatznachweis nicht möglich. Für entsprechende Antragsteller stellt
die Parkplatzablöse von derzeit 5.100 € pro Stellplatz ein
Investitionshindernis dar. Gerade im Hinblick auf die Beseitigung von
Leerständen kann dies zu Problemen führen. Ziel der kommunalen Satzung soll daher
die Entlastung von kleineren Gewerbeeinheiten und von Wohnnutzungen in der
Innenstadt sein.
Durch die
Novellierung der BauO NRW ist es der Gemeinde überlassen, die Stellplatzpflicht
beispielsweise für genehmigungspflichtige Nutzungsänderungen auszusetzen (s. §
3 Abs. 6 der Musterstellplatzsatzung). Alternativ kann eine Entlastung auch
durch eine Staffelung der erforderlichen Stellplätze nach Größe der
Gewerbelokale bzw. Wohnungen oder durch eine verminderte Parkplatzablöse im
Bereich zwischen den Wällen geregelt werden. Auch eine Kombination der
Instrumente ist möglich.
Parallel dazu wird
in der Mustersatzung die Pflicht zur Errichtung von entsprechenden
Fahrradanlagen im privaten bzw. im öffentlichen Raum durch Ablöse eingeführt.
Mit Hilfe der Satzung können so Anreize für die Nutzung umweltfreundlicher
Nahmobilität durch Förderung von Fahrradabstellanlagen oder Verknappung des
Parkraums geschaffen werden.
Umgekehrt soll in
der kommunalen Stellplatzsatzung für Emmerich die gestiegene Individualmobilität
gewürdigt werden, in dem bei neuen Bauvorhaben -außerhalb den bestehenden
verdichteten Bereichen- der Stellplatznachweis bedarfsgerecht festgelegt wird.
Hierdurch soll für alle Baugebiete künftig sichergestellt werden, dass
stadtweit ausreichend Parkplätze in den Baugebieten errichtet werden.
Weiteres Vorgehen
Bei der Aufstellung
der Satzung müssen alle Belange unter- und gegeneinander abgewogen werden.
Hierzu ist zunächst eine ausführliche Bestands- bzw. Bedarfsermittlung
notwendig. Aus diesem Grund soll hiermit ein Grundsatzbeschluss zur Erarbeitung
einer entsprechenden Satzung mit den o. g. Zielen gefasst werden.
Finanz- und
haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :
Die Maßnahme hat
keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.
Leitbild :
Die Maßnahme steht
im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 3.3.
In Vertretung
Dr. Wachs
Erster
Beigeordneter